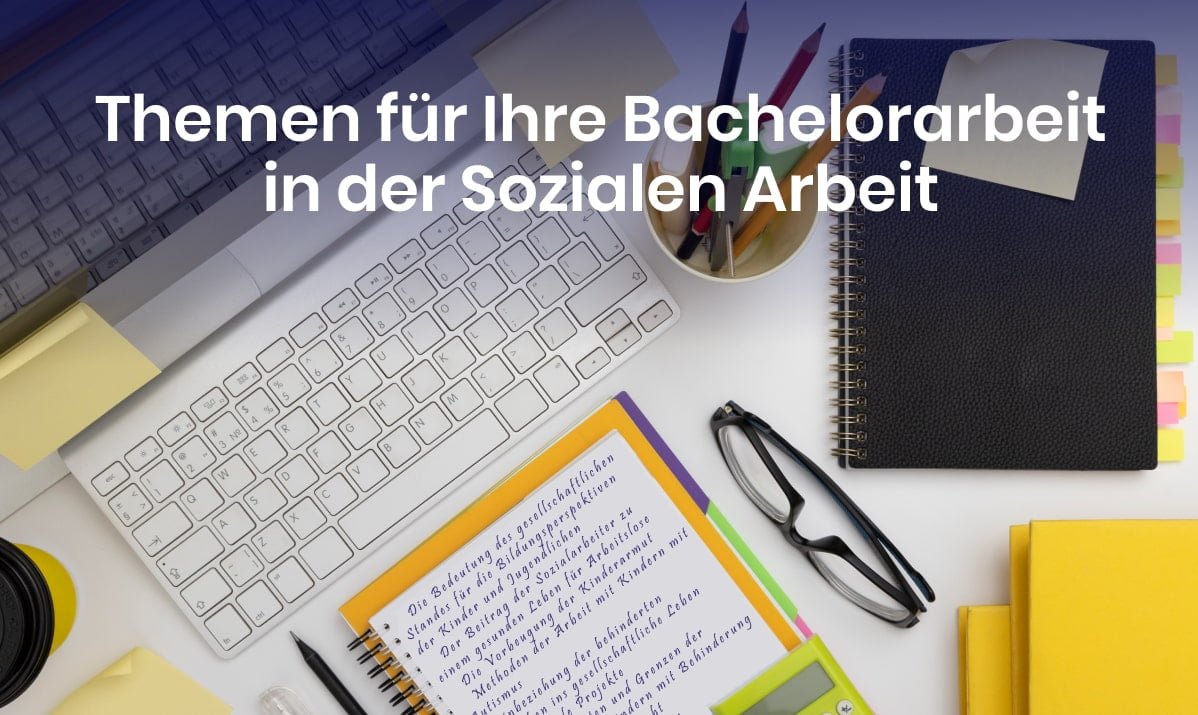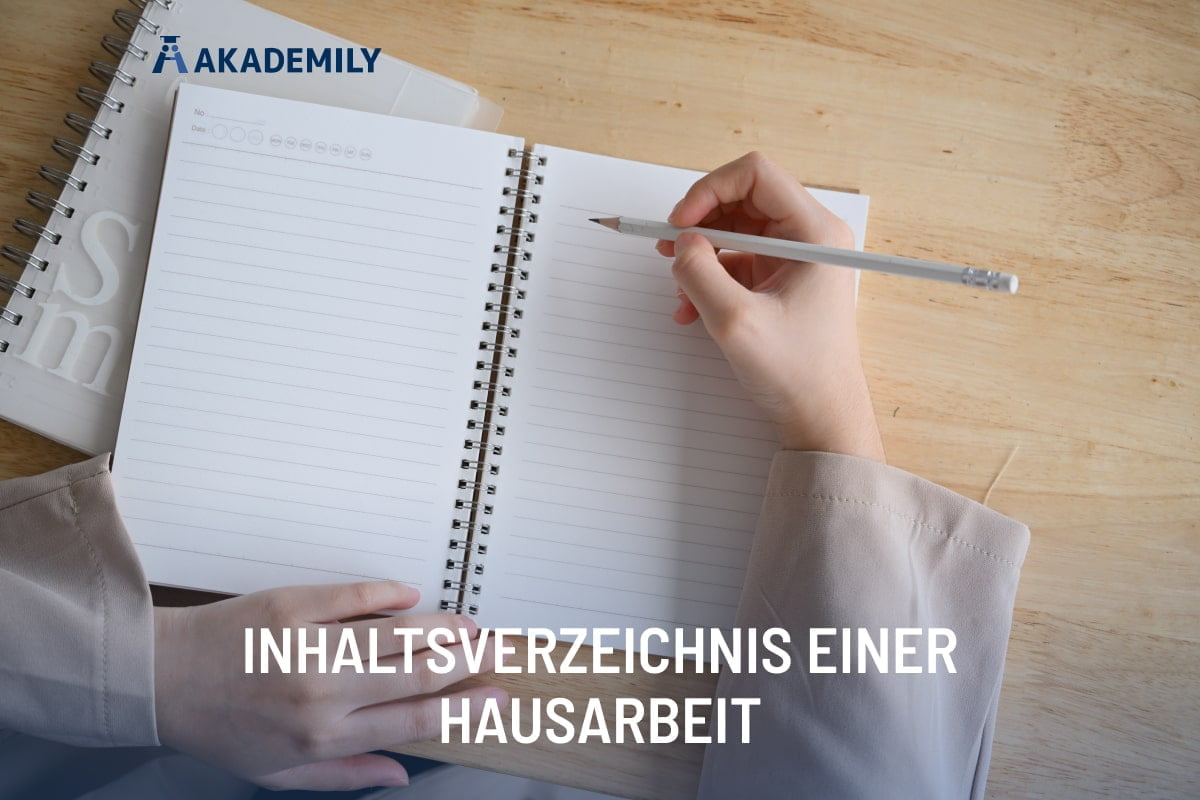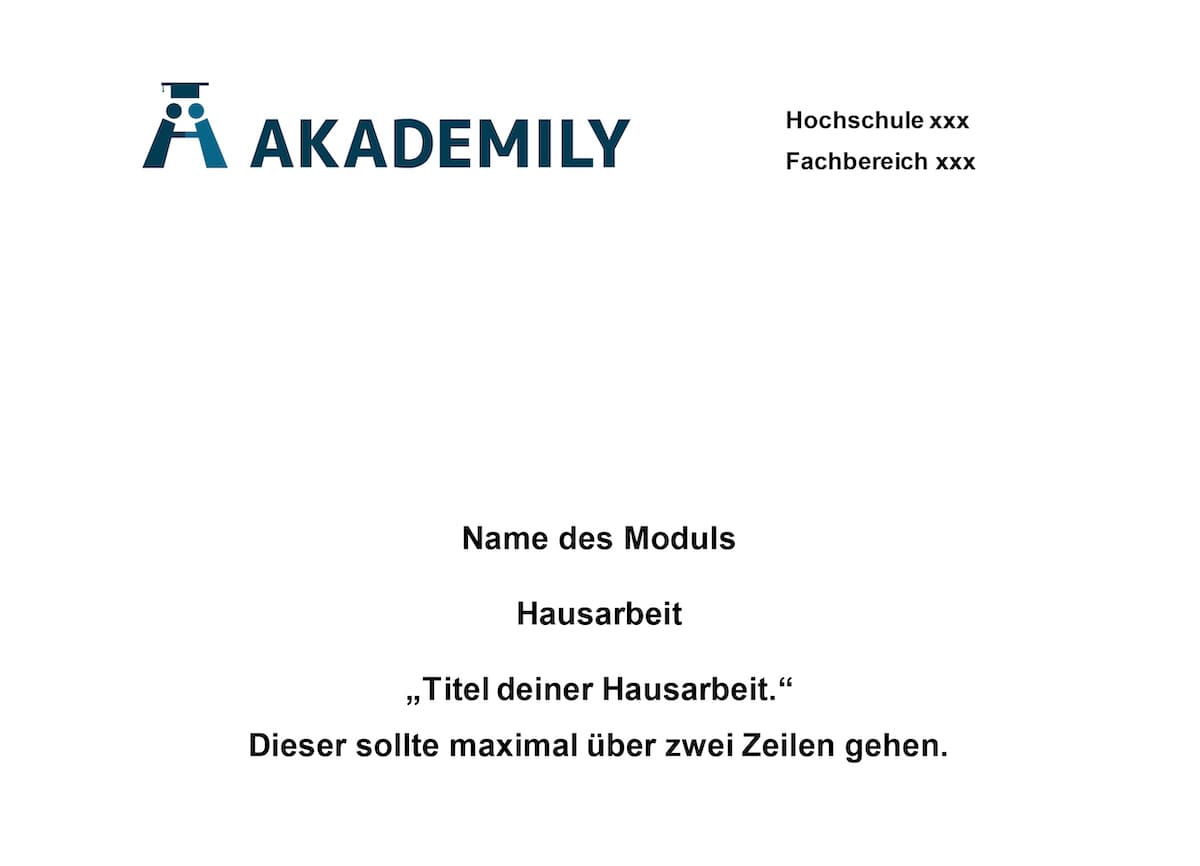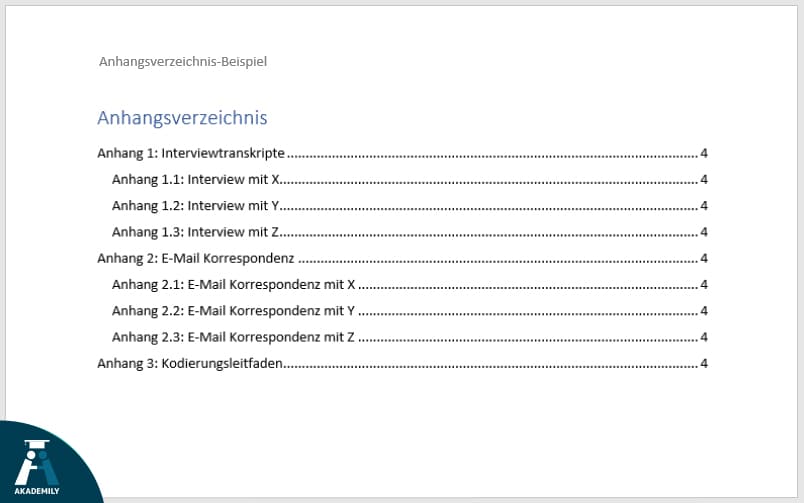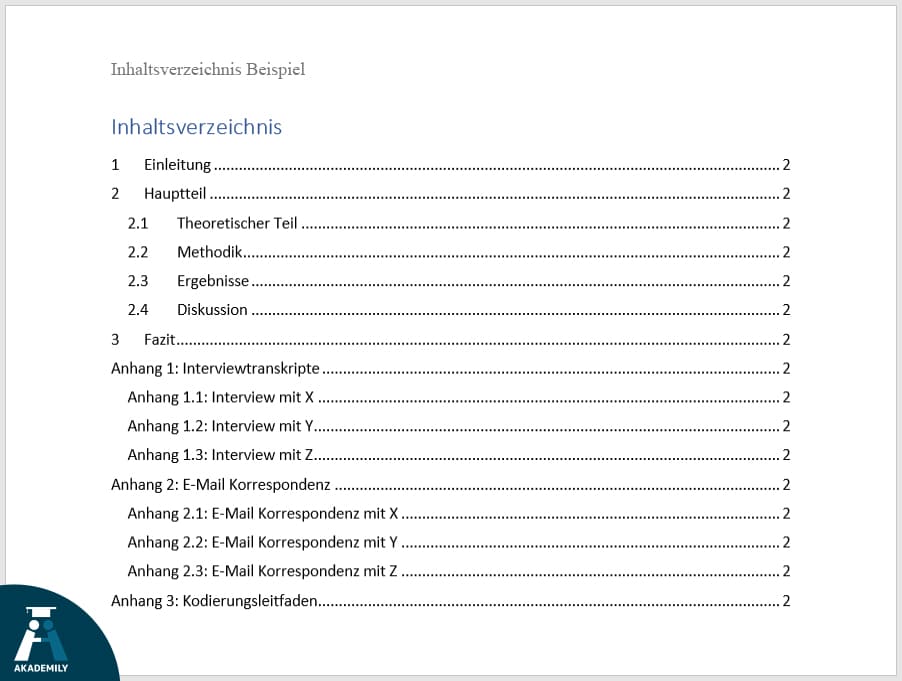Inhaltsverzeichnis
Die Harvard-Zitation ist auch unter weiteren Namen bekannt, darunter die beschreibende Form als „Autor-Jahr-Zitierweise“ oder auch schlicht als „amerikanische Zitation“. Grundsätzlich ist sie als Zitierweise im Fließtext gedacht, die nur durch Verweise auf das vollständige Literaturverzeichnis arbeitet.
Dadurch soll der Lesefluss erleichtert werden und es wird nur in Ausnahmefällen auf die zusätzliche Verwendung weiterer Anmerkungen, beispielsweise in Fußnoten, zurückgegriffen. Das bedeutendste Argument für die Harvard-Zitierweise ist dabei die äußerst hohe Verbreitung in der akademischen Welt rund um den Globus. Dies begründet sich vorwiegend durch ein relativ offenes Grundgerüst der geltenden Regeln.
Damit bietet diese Zitierweise die Möglichkeit, nach den lokalen Gepflogenheiten angepasst zu werden. Was sich zunächst durchweg positiv anhört, gerät jedoch oftmals auch schnell zu einer individuellen Version einer Hochschule, die nur noch auf einem originalen Grundgerüst basiert. Entsprechend unumgänglich ist es, vor der Umsetzung nochmals einen endgültigen Blick in die Zitier-Richtlinien der jeweiligen Hochschule zu werfen.
Als eine allgemeine Einführung, sowie zur Verwendung im Rahmen der eigenen Recherche, werden jedoch folgend die für gewöhnlich geltenden Regeln zusammengefasst. Wichtig ist wie bei jeder Form der Zitation jedoch vor allem, diese Regeln auch einheitlich und umfassend beizubehalten.
Das vordergründige Argument für die amerikanische Zitierweise ist ihre weite Verbreitung, vor allem im Bereich der Natur-, Geistes und Sozialwissenschaften und das nicht nur im anglofonen Sprachraum. Ihre Vorzüge zeigt diese Form der Quellenangabe vor allem bei der Bewertung oder dem Vergleich von umfassendem Quellenmaterial.
Insbesondere, wenn dieser Vergleich oder auch die Weiterführung der Ergebnisse Gegenstand der eigenen wissenschaftlichen Arbeit ist. Dabei behindert diese Zitierform den Lesefluss möglichst wenig, sondern verweist nur auf das Literaturverzeichnis, in welchem umfassende Informationen zum Quelltext gegeben werden.
Da viele Hochschulen oder wissenschaftliche Fachgebiete eine Form der Zitierweise vorgeben, ist der Studierende oftmals nicht in seiner Wahl frei. Während andere Formen der Quellenangabe jedoch recht starre Systeme, mit eigenen regelmäßigen Publikationen darstellen, ist die tatsächlich angewandte Autor-Jahr-Zitierweise oftmals eine eigens angepasste Variante.
Diese bedient sich dabei neben den allgemeinen Grundregeln der Harvard-Zitierweise weiterer Zusatzregeln. Deswegen wird oftmals auch vom „Harvard Style“ gesprochen. Entsprechend ist eine abschließende Aussage über die geltende Vorgabe der Zitierform tatsächlich immer erst nach einem Blick in die Angaben der betreffenden Hochschule möglich.
Grundregeln der Harvard-Zitierweise

Dennoch sind einige allgemeingültige Grundregeln in Bezug auf den Harvard-Style gegeben. Diese bieten einen gemeinsamen roten Faden, welcher es ermöglicht, die individuellen Abweichungen schnell zu adaptieren. Darin liegt entsprechend die weitreichende Verbreitung begründet und es erlaubt dem Leser gleichsam eine entsprechend schnelle Identifizierung der genannten Quellen.
Die Quellen werden direkt im Fließtext gekennzeichnet. Dabei wird in Klammer zunächst der Nachname des Autors und das Jahr der Veröffentlichung genannt, gefolgt von der Seitenangabe. Es wird für gewöhnlich entweder nach der Jahreszahl ein Doppelpunkt eingefügt oder ein Komma in Kombination mit einem „S.“ für Seite.
Schema:
(Nachname Veröffentlichungsjahr: Seite)
oder
(Nachname Veröffentlichungsjahr, S. Seite)
Beispiele:
„Mehr sag ich nicht, doch sag ich nicht zuviel.“(Dante 1974: 17)
oder
„Mehr sag ich nicht, doch sag ich nicht zuviel.“(Dante 1974, S. 174)
Grundsätzlich sollte innerhalb einer Arbeit dabei jedoch stets eine Form gewählt und auch beibehalten werden.
Sollten zwei Autoren mit gleichem Nachnamen und übereinstimmendem Veröffentlichungsjahr genutzt werden, wird durch den abgekürzten ersten Buchstaben des Vornamens nach dem Nachnamen die Möglichkeit der Unterscheidung gewährleistet.
Wird mehr als eine Quelle vom selben Autor, aus demselben Jahr genutzt, so wird an die Jahreszahl ein Kleinbuchstabe (a, b, c, …) zur Unterscheidung angehängt. Dies geschieht sowohl im Text als auch im Literaturverzeichnis.
Direkte und indirekte Zitate

Insbesondere wenn ein entsprechendes Zitat unverändert in einen eigenen Kontext eingebunden wird, ist es wichtig, die Quelle klar als solche kenntlich zu machen. Wird dabei der Wortlaut vollständig übernommen, spricht man von einem direkten Zitat. Dieses wird durch Anführungszeichen gekennzeichnet. Wird der Gedankengang des ursprünglichen Autors in die eigene Überlegung einbezogen, spricht man von einem indirekten Zitat. Letzteres wird dabei mittels eines vorgestellten „vgl.“ für „vergleiche“ gekennzeichnet.
Beispiel direktes Zitat:
Dabei wird der Begriff des Symbols für „einen Gegenstand der Außenwelt im weitesten Sinne des Wortes“ (Schütz 1974, S.166) verwendet.
Beispiel indirektes Zitat:
Dabei misst er dem Lebenswillen oder auch dem seelischen Antrieb, in Relation zur physischen Belastbarkeit, eine übergeordnete Bedeutung zu (vgl. Aurel 1981, S. 100).
Dabei gilt es zu beachten, dass die Quellenangabe grundsätzlich innerhalb des Satzes steht und nicht an diesen angehängt wird. Bei direkten Zitaten erfolgt sie direkt im Anschluss an die Anführungszeichen, bei indirekten am Ende des Satzes, jedoch stets vor dem Satzzeichen.
Weitere Anwendungsbeispiele
Die Grundformen werden je nach Anzahl der Autoren, sowie der Art der Veröffentlichung weiter angepasst:
Zwei Autoren eines Werkes:
Bei mehreren Verfassern werden diese durch einen Schrägstrich voneinander getrennt.
Beispiel:
(Edmüller/Wilhelm 2005, S. 31)
Mehrere Autoren eines Werkes:
Waren darüber hinaus noch weitere Autoren an der Veröffentlichung beteiligt, werden diese allesamt angegeben und mit Schrägstrichen getrennt.
Beispiel:
(vgl. Rues/Redecker/Koch/Wallraff/Simpson, S. 37)
Mehrere Autoren mehrerer Werke:
Hierbei erlaubt die Harvard-Zitierweise die Nennung beider Werke in derselben Klammer. Vorwiegend kommt dies bei indirekten Zitaten zur Anwendung, kann jedoch seltener auch dazu dienen, mehrere Belege zur Verdeutlichung anzuführen. Dabei werden diese grundsätzlich durch ein Semikolon voneinander getrennt.
Schema:
(vgl. Nachname Veröffentlichungsjahr, S. Seite; Nachname Veröffentlichungsjahr, S. Seite)
Sammelbände und Zeitschriften:
Bei einer Veröffentlichung in einem Sammelband wird bei der Quellenangabe im Text verfahren, als ob es sich um eine Monografie oder auch ein Werk mehrerer Verfasser handeln würde. Die Präzisierung bezüglich des Gesamtwerks oder der Zeitschriftenausgabe erfolgt erst später im Literaturverzeichnis.
Beispiele:
(Porges/Schertier/Bunk 2021, S. 48)
(vgl. Bittner 1984, S. 103)
Internetquellen:
Unabhängig davon, dass es sich um kein gedrucktes Medium handelt, wird auch hier auf eine weiterführende Kennzeichnung verzichtet. Die Quellangabe erfolgt unter Angabe von Nachname des Verfassers und dem Veröffentlichungsjahr.
Beispiel:
(Dietrich 2009)
Veränderungen und deren Kenntlichmachung

Da die Quellangabe darauf ausgelegt ist, den Lesefluss nach Möglichkeit nicht zu behindern, gilt dies ebenso für die verwendeten Zitate. Dabei ist jedoch jede Form der Veränderung optisch kenntlich zu machen. Selbstverständlich darf durch eine Änderung der ursprüngliche Sinn nicht verfälscht werden.
Auslassungen:
Wird ein Teil des ursprünglichen Zitates gekürzt, so ist diese Auslassung an der betreffenden Stelle mithilfe eckiger Klammern anzuzeigen, welche drei Punkte umfassen. Dies gilt auch, wenn dabei das Satzende gekürzt wird.
Beispiel:
„Mit den erwähnten Märkten sind Lebensmittelmärkte verbunden, […] diese aber auf besonderen Plätzen außerhalb der Stadt, […]“ (Morus 1985, S.75)
Veränderungen:
Analog werden auch eigene Abwandlungen durch eckige Klammern angezeigt. Dies geschieht ebenfalls zur Verbesserung der Lesbarkeit. Zumeist geschieht dies in Form von Abwandlungen wie vom Singular auf den Plural oder durch Konjugation eines Verbs.
Beispiel:
Dabei betonen die Autoren explizit: „Der Handlungsplan [sei] eines der wichtigsten Instrumente der Moderation.“ (Edmüller/Wilhelm, S. 83)
Anmerkungen:
Werden explizite Anmerkungen durch den Verfasser gemacht, die beispielsweise zur Präzisierung oder Klarstellung dienen, so werden diese ebenfalls durch eckige Klammern umschlossen. Darüber hinaus werden sie zusätzlich als solche gekennzeichnet. Dadurch wird kenntlich gemacht, dass der Inhalt der Klammer nicht aus der Quelle entnommen wurde, sondern diese erläutert ohne das ursprüngliche Zitat gänzlich umstellen zu müssen.
Beispiel:
„Sie [Anm. d. Verf.: die Kritische Theorie] sollte ein skeptisches Gegenstück sein zu einem rein optimistischen Vertrauen auf die Vernunft.“ (Dietrich 2009)
Verbesserungen:
Enthält die zitierte Textstelle einen offensichtlichen Fehler in Bezug auf Grammatik oder Orthografie, so muss das Zitat dennoch in korrekter Weise wiedergegeben werden. Dabei wird dem betreffenden Wort ein „sic“ mit Ausrufezeichen in eckigen Klammern nachgestellt.
Dies ist ein redaktioneller Hinweis, der sich aus dem lateinischen ableitet und „so“ oder gar „wirklich so“ bedeutet. Bei Texten, die sich noch der alten Rechtschreibung bedienen, wird aus Gründen der Lesbarkeit jedoch gemeinhin auf eine Kennzeichnung verzichtet.
Literaturverzeichnis

Dem Literaturverzeichnis kommt besondere Bedeutung zu. Während die Quellenangaben im Harvard-Style auf eine möglichst gute Lesbarkeit abzielen, muss das Literaturverzeichnis eine detaillierte Angabe der genutzten Ausgabe verzeichnen.
Das grundlegende Schema nutzt dabei den Nachnamen des Autors und mindestens den abgekürzten Anfangsbuchstaben des Vornamens, gefolgt vom Veröffentlichungsjahr in runden Klammern. Danach folgen Angaben zum Titel, dem Verlagsort und Verlag. Weitere Angaben wie beispielsweise Sammelband, Internetlink oder auch Jahrgang, Nummer und gegebenenfalls Seitenangaben bei Zeitschriften werden anstatt dem Verlagsort und Verlag ergänzt.
Dabei werden diese zumeist durch weitere Angaben wie „In:“ oder „Link:“ zusätzlich gekennzeichnet. Online Quellen sollten zudem stets mit dem Datum des letzten Aufrufs gekennzeichnet werden.
Schema:
Nachname, Vorname (Veröffentlichungsjahr): Titel. Untertitel. Verlagsort: Verlag.
Beispiele:
| Dante (1974): Die Göttliche Komödie. Frankfurt am Main: Insel Verlag. |
| Schütz, Alfred (1974): Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine Einleitung in die verstehende Soziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. |
| Aurel, Marc (1981): Selbstbetrachtungen. Essen: Magnus-Verlag. |
| Edmüller, A. / Wilhelm T. (2005). Moderation. Planegg: Rudolf Haufe Verlag GmbH & Co KG. |
| Rues, Beate / Redecker, Beate / Koch, Evelyn / Wallraff Uta / Simpson Adrian (2007): Phonetische Transkription des Deutschen. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co KG. |
| Porges, L. / Schertler, O. / Bunk, M. (2021): Alter Soldat. Das sowjetische Gorjunow MG SG-43. In: Clausewitz, Jahrgang 11, Nr. 1, S. 46 – 49. |
| Bittner, Günther (1984): Gehorsam und Ungehorsam. In: Flitner, A. / Scheuerl, H. (Hrsg.): Einführung in pädagogisches Sehen und Denken. München: R. Piper & Co. Verlag. |
| Dietrich, Kirsten (2009): Die religiöse Wende des alten Philosophen. Link: https://www.deutschlandfunkkultur.de/die-religioese-wende-des-alten-philosophen.950.de.html?dram:article_id=137899 [Stand: 23.05.2021] |
| Morus, Thomas (1985): Utopia. Stuttgart: Reclam |
Weitere gebräuchliche Regeln und Vereinfachungen:
Um dem Verfasser die Gestaltung seines Textes zu erleichtern, gibt es weiterhin eine Vielzahl von verschiedenen Regeln, die als gemeinhin gültig angenommen werden. Auch bei diesen steht wieder die Lesbarkeit im Fokus. Im Zweifelsfall entscheidet jedoch die individuelle Vorgabe der Hochschule über die Verwendung. Die gebräuchlichsten sind:
- Mehrere Autoren können außer durch einen Schrägstrich oftmals auch durch ein Semikolon oder das Wort „und“ getrennt werden.
- Bei mehr als zwei Autoren besteht zumeist die Möglichkeit, alle Verfasser nach dem ersten mit „et al.“ zusammenzufassen. Das lateinische „et alii/et aliae/et aliaa“ entspricht dabei dem deutschen Kürzel „u. a.“.
- Wird eine Quelle mehrfach zitiert, ohne dass sich zwischenzeitlich weitere Zitate im Text finden, so kann ab dem zweiten Zitat (ebd.) oder (vgl. ebd.) für „ebenda“ eingefügt werden.
- Werden besonders lange direkte Zitate eingefügt, so werden sie gemeinhin um 1 cm eingerückt. Weiterhin wird der Zeilenabstand auf einfach gesetzt und der Schriftgrad zudem um eine Größe verringert. Lange Zitate beginnen ab 40 Wörter.
- Fußnoten werden im Harvard-Style soweit möglich vermieden. Lediglich wenn weitere wichtige Anmerkungen an der betreffenden Stelle notwendig erscheinen, die im Text jedoch zu ausführlich wären, greift man auf diese zurück. Für Quellenangaben werden sie generell im Rahmen der Harvard-Zitierweise nie verwendet.
Autoren und Sprachen
Wer erstellt meine Arbeit?
Alle unsere Experten haben Bachelor-, Master- oder Doktorabschlüsse und jahrelange Erfahrung im Ghostwriting. Unter unseren Autoren gibt es keine Studenten oder nicht verifizierte Autoren. Sie entscheiden selbst, wer Ihre Arbeit erstellen wird. Kontaktieren Sie uns und unsere Manager erzählen Ihnen gerne über freie Experten für Ihren Auftrag!
Kann ich den Autor selbst auswählen?
Ja, sicher! Wir erzählen ausführlich über freie Experten, die Ihre Arbeit verfassen können, beantworten Ihre Fragen und Sie wählen selbst nach Ihren Kriterien einen Experten aus, der Ihrer Ansicht nach am besten für die Erstellung Ihrer Arbeit geeignet ist.
Kann ich direkt mit dem Autor kommunizieren?
Ja, Sie können vor und auch im Laufe der Arbeit anonym und kostenfrei mit dem Ghostwriter in einem Chat bzw. einer Videokonferenz ohne Kamera chatten, wir sorgen für Ihr Vertrauen und Ihre Sicherheit.
Ist Deutsch die Muttersprache der Autoren?
Wenn Sie uns eine Arbeit in deutscher Sprache schreiben lassen, garantieren wir, dass Ihre Arbeit von einem Ghostwriter verfasst wird, dessen Muttersprache Deutsch ist.
In welchen Sprachen können Sie akademische Arbeiten schreiben?
Wir bieten Ghostwriting-Dienstleistungen in folgenden Sprachen an: Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch und Französisch. Alle Autoren sind Muttersprachler und hochqualifizierte Spezialisten in ihrem Fachgebiet. Wenn Sie möchten, dass ein deutscher Autor Ihre Arbeit in einer anderen Sprache erstellt, dann ist das beim Vorhandensein eines solchen Autors auch möglich.
Welche Arbeitserfahrungen haben die Ghostwriter?
Die meisten unserer Autoren arbeiten mit uns seit dem ersten Tag der Gründung unserer Agentur zusammen, ihre Erfahrungen im akademischen Schreiben erstrecken sich zwischen 2 und 50 Jahren. Wir arbeiten ausschließlich mit den Autoren, die die validierten Bachelor-, Master- und Doktorabschlüsse haben.
Hat der Autor Qualifikation in meinem Fachgebiet?
Ja, alle Autoren werden streng geprüft und befassen sich nur mit den Bestellungen in ihrem nachgewiesenen Wissensbereich.
Kann ich sicher sein, dass der Ghostwriter ein qualifizierter Fachmann ist?
Alle unsere Ghostwriter bestehen eine strenge Prüfung vor der Auftragserteilung. Wir prüfen bei den Kandidaten Abschlussurkunden, wissenschaftliche Artikel und sonstige Dokumente. Außerdem bestehen sie Tests für Schreibstandards und ein Interview mit einem VIP-Autor aus ihrem Fachgebiet.
Wird von den Ghostwritern künstliche Intelligenz bei der Erstellung von Arbeiten verwendet?
Nein, alle Ghostwriter unterzeichnen in unserer Agentur einen Vertrag, wo einer der Hauptpunkte Verbot des Einsatzes künstlicher Intelligenz oder jeglicher neuronaler Netze ist.
Qualität der Arbeiten
Wird der Ghostwriter meinen Anweisungen folgen und die Dokumente verwenden, die ich ihm bereitstelle?
Ja, sicher. Unser Prinzip ist es, die Arbeiten unserer Kunden gemäß allen ihren Anforderungen und Wünschen auszuführen. Alle Unterlagen, Hinweise und Wünsche werden bei der Erstellung der Arbeit berücksichtigt und verwendet.
Wenn ich keine Materialien für die Arbeit habe, sondern nur ein Thema?
Macht nichts, der Ghostwriter kann selber das Thema erschließen und die Arbeit aufgrund zuverlässiger wissenschaftlicher Quellen erstellen, Ihre Arbeit wird einzigartig sein. In diesen Fällen haben Sie die Möglichkeit, mittels Teillieferungen zu prüfen, ob Ihnen die Darstellung des Themas gut gefällt. Ihre Korrekturen, falls vorhanden, werden vom Autor berücksichtigt.
Wird meine Arbeit einzigartig sein?
Ja, alle Arbeiten werden immer für jeden Kunden individuell geschrieben. Wir prüfen die Arbeit auf Einzigartigkeit mithilfe spezieller Software, die auch die deutschen Hochschulen verwenden. Die Einzigartigkeit beträgt bei uns immer mindestens 92 %. Ihrer Arbeit wird absolut kostenlos ein Einzigartigkeitsbericht beigelegt.
Nach welchen Standards wird die Arbeit geschrieben?
Wir schreiben die Arbeiten nach den von Ihnen vorgegebenen Standards, da diese an verschiedenen Hochschulen unterschiedlich sein können. Wenn es keine gibt, verwenden wir Standardvorlagen für die Schreibarbeit.
Besteht die Arbeit die Qualitätskontrolle?
Ja, die endgültige Arbeit wird noch einmal von einem professionellen Korrektor geprüft, außerdem wird sie auf Übereinstimmung mit den ursprünglichen Anforderungen und Wünschen des Auftraggebers überprüft. Literaturquellen werden auf Verfügbarkeit und Konformität, Formatierungsstandards, Themenerschließung usw. überprüft.
Details und Arbeitsablauf
Ist Ghostwriting legal?
Ja, Ghostwriting ist in Deutschland legal. Sie können die von einem Ghostwriter erstellte Arbeit als Referenz beim Verfassen Ihrer eigenen Arbeit verwenden oder zur Überprüfung Ihrer eigenen Untersuchung u. ä. benutzen. Sie dürfen nur die von einem Ghostwriter geschriebene Arbeit nicht als Ihre eigene ausgeben.
Ist es möglich, nur einen Teil einer wissenschaftlichen Arbeit zu bestellen?
Ja, das ist möglich. Wir können für Sie auch nur einen oder einige bestimmte Teils der Arbeit vorbereiten wie etwa Literaturverzeichnis, Einleitung, Arbeitsplan oder Recherche, wir helfen Ihnen auch bei der Themenauswahl. Wenn Sie die Arbeit selbst geschrieben haben und nur Lektorat oder Korrekturlesen benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Können Sie eine Arbeit dringend schreiben?
Wir schreiben erfolgreich dringende Arbeiten, auch manchmal binnen eines Tages. Wir haben dafür eine Abteilung für Eilaufträge, wo sich die Autoren ausschließlich mit dringenden Arbeiten beschäftigen.
Wieviel Zeit braucht ein Ghostwriter, um eine Arbeit zu schreiben?
Das ist von dem Thema, der Komplexität und dem Umfang der Arbeit abhängig. Wir hatten in unserer Praxis den Fall, als ein Ghostwriter binnen 24 Stunden eine 16-seitige Arbeit verfasst hat. Stellen Sie eine unverbindliche Anfrage, geben Sie Ihren genauen Termin an und unsere Manager beraten Sie gerne.
Garantieren Sie eine gute Note?
Nein, das können wir leider nicht garantieren. Die Note für die Arbeit hängt nicht nur vom geschriebenen Text, sondern auch von anderen Faktoren ab, die außerhalb unserer Befugnisse liegen. Wir bieten Ihnen deshalb Teillieferungen der Arbeit, damit Sie Ihre Arbeit im Voraus lesen und, falls erforderlich, korrigieren lassen können.
Darf ich die Arbeit korrigieren lassen?
Ja, Sie dürfen Ihre Arbeit im Laufe ihrer Erstellung sowie 2 Wochen nach Ablauf der Frist völlig kostenfrei entsprechend den Ausgangsanforderungen korrigieren lassen. Für viele Arbeiten gibt das Unternehmen eine lebenslange Garantie.
Schicken Sie fertige Teile der Arbeit?
Ja, Ihr Vertrauen und Ihre Sicherheit sind uns wichtig. Es wird Ihnen auch dabei helfen, sich schrittweise mit dem Material vertraut zu machen und gegebenenfalls schnell Korrekturen vorzunehmen.
Kann ich den Fortschritt meiner Arbeit überwachen?
Ja, natürlich! Ihrem Projekt sind 2 persönliche Manager zugeordnet. Einer von ihnen überprüft gerade den Fortschritt Ihrer Arbeit und informiert Sie und den Ghostwriter über alle Änderungen.
Kann ich meinen Auftrag stornieren?
Ja, Sie können Ihren persönlichen Betreuer darüber jederzeit informieren. In diesem Fall bezahlen Sie nur die bereits fertiggestellten Teile Ihrer Arbeit.
Wer überwacht mein Projekt?
Dem Projekt sind 2 persönliche Manager zugeordnet. Der erste ist Ihr Berater zu Arbeitskosten und -bedingungen. Der zweite Manager überwacht den Fortschritt der Arbeit und steht in ständigem Kontakt mit dem Kunden und dem Autor.
Was kann ich tun, wenn ich mit der geschriebenen Arbeit nicht zufrieden bin?
Diese Fälle sind in unserer Praxis sehr selten. Sie erhalten immer zuerst fertige Teile Ihrer Arbeit, um diese zu bewerten und korrigieren zu lassen. Außerdem haben Sie noch folgende Möglichkeiten: Sie können einen anderen Autor verlangen oder sich mit Ihrer Anfrage an die Betreuungsabteilung wenden, und unsere Manager werden so schnell wie möglich Ihre Anfrage beantworten.
Preise und Zahlungsverfahren
Kann ich in Raten zahlen?
Ja, natürlich. Sie können Ihren Auftrag in Teilen bezahlen, wir empfehlen jedoch die Gesamtzahlung, da der Autor in diesem Fall sofort die ganze Arbeit erstellt, ohne auf Nachzahlungen zu warten. Sie können auch Teile Ihrer Arbeit erhalten, um genau zu wissen, dass Ihre Arbeit so erstellt wird, wie Sie es sich wünschen.
Mache ich mich mit einer Zahlung strafbar?
Nein, Sie machen sich nicht strafbar. Ghostwriting ist in Deutschland nicht nur legal, sondern auch eine jahrhundertealte Praxis. Sie dürfen aber nicht, die von uns verfasste Arbeit unverändert als Ihre einzureichen.
Können andere Personen für mich bezahlen?
Ja, eine andere Person darf für Sie bezahlen. Teilen Sie dieser Person Ihre Auftragsnummer mit. Sobald deren Zahlung bei uns eingegangen ist, wird diese Ihnen gutgeschrieben.
Wie kann ich bezahlen?
Sie können eine Banküberweisung vornehmen oder sofort über Zahlungssysteme bezahlen, indem Sie auf den Link in der Rechnung klicken. Akzeptiert werden Kredit- oder Debitkarte (Visa, MasterCard, American Express), Mobile-Payment-Zahlungssysteme (Google Pay, Apple Pay) und Online-Bezahlverfahren (Klarna, Giropay). Teilzahlungen sind auch möglich.
Können die Kosten im Laufe der Auftragserfüllung ändern?
Ja, wenn Sie während der Erstellung Ihrer Arbeit neue Daten angeben oder eine der Hauptbedingungen ändern wie etwa das Thema der Arbeit oder die Anzahl der Seiten, so können die Kosten neu berechnet werden. Sofern Korrekturen eine Erhöhung der Seitenzahl erfordern, werden diese ebenfalls gesondert vergütet.
Betreuungsabteilung
Was konkret soll ich schreiben?
Sie stellen Ihre Frage oder beschreiben Ihr Problem und geben Ihre Bestellnummer an. Die Bestellnummer finden Sie auf der Rechnung oder im ersten Schreiben, das Sie vom Unternehmen erhalten haben.
In welchen Fällen kann ich mich an die Betreuungsabteilung wenden?
Sollten sich Ihre persönlichen Betreuer nicht melden, können Sie eine Anfrage bei der Betreuungsabteilung stellen. Wenn die Manager Ihre Frage nicht selbständig lösen können, dann wenden Sie sich bitte an uns.
Wozu wurde die Betreuungsabteilung organisiert?
Die Betreuungsabteilung funktioniert unabhängig und hilft unseren Kunden bei der Lösung von Anfragen, falls die Manager ein Problem nicht lösen oder eine Frage nicht beantworten können. Der Ruf unseres Unternehmens liegt uns am Herzen und wir verbessern unseren Service ständig.
Vertraulichkeit
Wird der Autor oder jemand noch meine Daten kennen?
Nein, alle Ihre Daten ebenso wie unsere Kommunikation werden verschlüsselt und nicht an Dritte weitergeleitet. Der Ghostwriter erhält nur die Anforderungen und Wünsche zum Verfassen der Arbeit. Außerdem unterzeichnen unsere Autoren eine Vertraulichkeitsvereinbarung.
Werden meine persönlichen Daten bei Ihnen geschützt?
Ja, in unserem Unternehmen gelten allgemeine Datenschutzbestimmungen, so dass die persönlichen Daten unserer Kunden werden nie veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben.
Geld-Zurück-Garantie
In welchen Fällen garantieren Sie die Rückerstattung von 100 % des eingezahlten Geldes?
Wir garantieren Ihnen eine vollständige Rückerstattung in folgenden Fällen: 1. Das Unternehmen hat die Arbeit nicht fristgemäß dem Auftraggeber übergeben, es sei denn, mit dem Auftraggeber wurde etwas anderes vereinbart. Wenn der Auftraggeber und der Betreuer vereinbart haben, den Liefertermin zu verschieben, gilt dieser Termin als Endtermin. 2. Wenn das Werk nicht einzigartig ist. Das Unternehmen ist verpflichtet, ein Werk mit Einzigartigkeit von mindestens 92 % zu liefern. Der Plagiatsbericht des im Prüfsystem PlagScan geprüften Werkes ist eine Bestätigung der Einzigartigkeit des Werkes. 3. Technischer Fehler bei der Bezahlung der Bestellung. Die Zahlung wurde aufgrund von technischen Problemen mit dem Provider, dem Browser oder anderen Systemfehlern zweimal durchgeführt und/oder der Auftraggeber hat versehentlich zweimal für identische Bestellungen bezahlt.
Kann ich mit einer Rückerstattung eines Teils des eingezahlten Geldes rechnen?
Ja, wenn Sie sich während des Erstellungsprozesses beschlossen haben, die Bestellung zu stornieren. In dieser Situation ist das Unternehmen verpflichtet, Ihnen das Geld für den noch nicht geschriebenen Teil Ihrer Arbeit zurückzuerstatten.
In welchen Fällen kann das Unternehmen eine Rückerstattung verweigern?
Der Auftraggeber weigert sich, Anpassungen im Prozess vorzunehmen, und verlangt eine Rückerstattung. Der Auftraggeber schickt eine gefälschte Bestätigung, dass er die Arbeit nicht erhalten hat. Die verspätete Ablieferung der fertigen Arbeit ist auf das Verschulden des Auftraggebers zurückzuführen. Dazu gehören Zahlungsverzug, einschließlich zusätzlicher Gebühren für Änderungsaufträge, Verzögerung bei der Bereitstellung notwendiger Quellen oder verspätete Antworten auf unsere Anfragen. Nicht rechtzeitiger Eingang von Bestellungen aufgrund von technischen Problemen beim Provider, dem Browser oder Systemfehlern auf der Seite des Auftraggebers. Der Auftraggeber hat die Frist freiwillig verlängert. Wird ein Rückgabeantrag nach Ablauf der Frist eingereicht, ist keine Rückerstattung möglich, da das Fehlen eines Rückgabeantrags bedeutet, dass der Auftraggeber die Qualität der Arbeit akzeptiert hat. Diese Regeln gelten sowohl für den aktuellen Zustand der Arbeit als auch für die fertige Arbeit*. *** Die Rückerstattungsfrist beträgt 14 Tage nach dem auf der Bestellung angegebenen Lieferdatum, sofern mit dem Kunden nichts anderes vereinbart wurde.